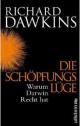Meeresbewohner | 11.01.2010
Phönix aus der Flasche

Ganz anders sehen viele Meeresbewohner solche Vorgänge. Für sie ist eine Getränkedose kein Müll, sondern ersehnter Lebensraum. Und wer passt besser in eine leere Bierflasche als ein Schleimfisch? Geschützt von allen Seiten kann ihm kaum ein Räuber in seine Behausung folgen – selbst ein Krake nicht, von dem man sagt, dass er fähig sei, durch das kleinste Loch zu schlüpfen. Der Oktopus auf dem Foto ist bei seinem Versuch, aus einer Flasche wieder herauszukommen, stecken geblieben und gestorben.
Menschlicher Abfall im Meer: Die Natur integriert ihn und von Substratlaichern wird er genutzt, um ihre Nachkommen darauf großzuziehen – so etwa das Pärchen Anemonenfische (Amphiprion polymnus), dem die Lage der Bierdose direkt vor ihrer Wirtsanemone ideal passt, um darauf abzulaichen. Die im Sand eingegrabene Dose kann nicht mehr wegrollen, hat glatte Flächen zum Befestigen des Eigeleges und kann schnell von den Elternteilen aus der Anemone erreicht werden, sobald Nesträuber wie die gierigen Lipp- und Falterfische sich nähern.
Mehr als woanders – wen wundert’s – findet man auch in unseren Breiten Zivilationsmüll im Meer. So im holländischen Zeeland, das nunmehr von der offenen Nordsee abgeschlossen ist. Eingewandert aus dem Süden ist die Schwarzgrundel (Gobius niger), die man heute im Veerse Meer und im Grevelinger Meer beobachten kann. Aber in Zeeland gibt es an den Deichen nur große Steine mit wenigen Versteckmöglichkeiten für die Fische. Deshalb ist die Grundel froh, zur Fortpflanzungszeit im Frühjahr Blechdosen, alte Schuhe und was der Mensch sonst noch ins Wasser wirft, vorzufinden. Manchmal sieht man sie zwischen leeren Austerschalen hervorblicken. In der Balz sind die Grundeln weniger scheu und man kann die oft dunkelblau werdenden Tiere besonders dort turteln sehen, wo Müll am Boden liegt, wie am Ankerplatz von Segelschiffen am Grevelinger Meer. Auch dieser Substratlaicher heftet seine ellipsenförmigen Eier in und an weggeworfene Dosen und Büchsen. Und wehe, man kommt ihnen als Fotograf dann zu nahe. Mutig verteidigen sie ihr Gelege so lange, bis die Jungen geschlüpft sind.
Natur – das ist nicht nur ein großes Wort, sondern auch ein verwässerter Begriff. Reduziert man das Wort Natur auf seine eigentliche Bedeutung, nämlich die Kennzeichnung des Teils der Erde, der ohne menschliches Zutun zustande kam, so schrumpfen unsere Maßstäbe dahin. Das Bedürfnis nach Naturerlebnis ist groß und wächst offensichtlich im Gleichschritt mit der Bevölkerung, mit dem Wohlstand und der Mobilität der Bewohner von Industrie-Staaten. Zur gleichen Zeit aber opfert man die verbliebenen Reste ursprünglicher Natur materiellen Zielen. Ehe die Menschheit sich versah, hatte sie mit unbedachtem Tatendrang in all das, was die Evolution in nahezu vier Milliarden Jahren geformt hatte, soweit verändernd eingegriffen, dass die letzten Rückzugsgebiete freier Natur schnell aufzuzählen sind: die Eisregionen der Polkappen, die großen Wüsten, die schrumpfenden Reste tropischer Regenwälder und die Meere. Gerade letztere werden immer mehr zu einer „künstlichen Natur“, die die Mitwirkung des Menschen nicht verleugnen kann. Es ist nicht abzusehen, ob und wann diese Entwicklung je gestoppt, geschweige denn umgekehrt werden kann. Eine Rückgewinnung verlorener ursprünglicher Ökosysteme – etwa von Urwäldern – ist ohnehin nicht möglich. Es sei denn, Phönix, als Sinnbild des durch den Tod sich erneuernden Lebens, greift ein ...
Helmut Debelius