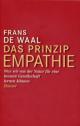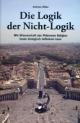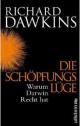Debatte | 10.02.2011
Imaginalität statt Spiritualität

von Dr. Andreas E. Kilian
Ein neuer Begriff kann einen alten Streit schlichten. Imaginalität ist die biologische Basis der Spiritualität. Das Numinose, Transzendente und Unerklärliche kann aus der Diskussion ausgeklammert werden.
Humanisten, insbesondere atheistische, haben mit der Spiritualität so ihre Schwierigkeiten. Spiritualität ist die individuelle Beschäftigung mit ... Ja, womit eigentlich? Für die einen ist es eine religiöse, für die anderen eine nicht-religiöse Beschäftigung mit seinem neuronalen Innersten. Naturalisten mögen den Begriff nicht, weil er die Trennung von Geist (Spiritus) und Körper suggeriert, die es laut Neurobiologie nicht geben kann. Psychotherapeuten und Esoteriker interpretieren eine Sinngebung hinein. Sinnsucher assoziieren mit diesem Begriff auch ihre Interpretationen von Ziel, Halt und Ordnung. Hierin finden sie Mut und Trost sowie ihre Stellung in der Welt und dem Kosmos. Die beiden großen Kirchen vereinnahmen das Wort Spiritualität, indem sie etwas Transzendentes und ihre Gottesvorstellung hineininterpretieren.
Und die Humanisten streiten sich darum, ob und wie sie dieses Wort verwenden dürfen. Auf der einen Seite sehen sie ein, dass es so etwas wie ein natürliches Vorkommen von Glauben, Aberglauben und Sinnsuche gibt, auf der anderen Seite wollen sie aber die damit assoziierten transzendenten Inhalte nicht in ihre Welt lassen. Weiterhin spaltet sich das Lager der Humanisten in ein Spektrum auf, welches von christlichen Fundamentalisten, über politisch Ambitionierte bis hin zu Idealisten reicht. Einige haben die humanistischen Vereinigungen subversiv unterwandert, andere wollen mit den Kirchen kuscheln, um einen Teil der Macht und der Steuergelder abzubekommen. Wieder andere sehen sich als konfliktfreudige Kämpfer mehr den strengen Idealen der Aufklärung verpflichtet. Für einen sinnvollen und allgemein akzeptierten Gebrauch unter den Humanisten könnte man den Begriff Spiritualität „reinigen“, wie es der Marburger Theologe Joachim Kahl vorschlägt, oder ganz neu definieren. Aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Konnotationen ist es jedoch sinnvoller und einfacher, einen neuen eindeutigen wissenschaftlichen Begriff zu prägen.
Was ist Imaginalität?
Religion ist eine nicht hinterfragbare Argumentationsebene, um immer das letzte Wort haben zu können. Religiosität ist – nach Definition einiger Religionswissenschaftler - ein biologisch veranlagtes und kulturell ausgeprägtes Verhalten zu überempirischen Akteuren. Ein Serienmörder, der innere Stimmen hört und ein Messer benutzt, handelt nach dieser Definition auch religiös. Spiritualität ist das rein individuelle Erleben von mystischen Phänomenen und neuronalen Capriolen. Da der Mensch aber als soziales Wesen nicht allein lebt, übernimmt er häufig auch die Ideen anderer, weshalb seine Spiritualität meistens auch Inhalte, Erfahrungen und Denkfehler anderer berücksichtigt.
Und was ist nun Imaginalität? Jeder kennt aus eigener Erfahrung heraus das Bedürfnis eine Ampel zu beschwören, damit sie grün bleibt oder wird. Wer fragt sich nicht, ob die schwarze Katze von vorhin nicht doch etwas mit der folgenden Situation zu tun hatte? Wer kennt nicht die Gefühle bei einem Sonnenauf- oder untergang. Wer spielt nicht immer die gleichen Lottozahlen, obwohl die Chance mathematisch betrachtet bei jeder Ziehung gleich ist? Auch Atheisten sind nicht frei von dem „kleinen“ Aberglauben im Alltag. Sie sind sich aber der Irrationalität solcher Vorstellungen bewusst und können diesen mit Humor begegnen. Sie haben keine Angst mehr vor den Feen und Kobolden in ihrem Garten.
Wir alle haben, dank der Evolution, von Natur aus neuronale „Software-Programme“ mitbekommen, die uns beim Denken etwas an die Hand nehmen und uns Vorschläge machen. Es gibt mehr Programme, als uns bewusst und lieb ist. Ähnlich wie bei den Gänseküken von Konrad Lorenz haben wir zum Beispiel Zeitfenster in unserer Kindheit, um unsere Eltern und Artgenossen als Bezugspersonen kennenzulernen. Wir suchen nach Personen, die uns als „allmächtig“ erscheinen, weil wir von ihnen lernen können und müssen. Und wer kennt nicht die berühmten Geister unter dem Bett, die uns ermahmen, uns zu verstecken und leise zu sein. Unser Gehirn projeziert uns Vorstellungen und Illusionen, damit wir das biologisch richtige Verhalten lernen, ohne jemals auf einen realen Feind treffen zu müssen. Streng genommen sehen wir keine Geister, sondern „Platzhalter“, damit wir eine generelle Angst und Vorsicht vor Raubtieren entwickeln. Dass dies Geister und transzendente Wesen sein sollen, wird uns erst hinterher suggeriert und beigebracht. Wer sich für frühkindliche Ängste interessiert erahnt bereits, welche Software-Programme in welchen Altersklassen anspringen, damit wir uns an unsere Umwelt anpassen können. Wir sind nicht nur genetisch an unser Habitat angepasst. Wir müssen wir uns als lernfähige Wesen auch kognitiv in unsere Nische einjustieren. Daher suchen wir nach all dem, was in der spirituellen Szene als Sinn, Halt, Ordnung und höherer Kontext bezeichnet wird. Wir wollen wissen, wer wir sind und welche Rolle wir in unserem Leben zu spielen haben. Unsere Glaubensinhalte sind häufig nichts anderes als Fehlinterpretationen unserer Software bei der Einjustierung in die aktuelle Realität unserer Umwelt.
Die Liste der erforderlichen Anpassungen kann noch weitergeführt werden. Es ist noch lange nicht alles bekannt und muss noch erforscht werden. Der kurze Überblick macht jedoch deutlich, dass es eine biologische Grundlage und Erklärung für viele Phänomene gibt, die unter ungünstigen Rahmenbedingungen zu einer Spiritualität oder Religiosität führen können. Und um die Grundlagen nicht mit den möglichen Folgen zu verwechseln, sollte zwischen biologisch notwendiger Imaginalität und Spiritualität unterschieden werden können.
Warum dieser Begriff?
Imaginalität leitet sich von dem lateinischen Wort Imago ab, was sowohl Bild und Ahnenbild, aber auch Trugbild, Traumbild, Bild im Geiste bis hin zu Vorstellung und Einbildung bedeuten kann. Der Begriff Imaginalität beschreibt das, was unsere Software uns anbietet: Ein Denken in Bildern und Vorstellungen; mit Bildern, die versuchen die Realität wiederzugeben und zu beschreiben, aber nicht die Realität sind; Gefühle, die zu Bildern werden können sowie eine Tendenz zum Wunschdenken, Lückenfüllen und Phantasieren. Kurz: Eine Vorstellungswelt, die uns als vorläufiges Raster zur Orientierung dient, weil wir nicht mit vollem Wissen zu Welt kommen können. Ein Raster, auf dem später mit weiteren Erfahrungen der Empirie aufgebaut werden kann.
Was bringt uns eine solche Unterscheidung zwischen Imaginalität und Spiritualität? Das erste Problem ist der Geist-Materie-Dualismus, der sich mit dem Wort Spiritualität verbindet. Mit dem Begriff Imaginalität wird deutlich, dass es ohne Gehirn keine Imaginationen geben kann. Damit wird auch gleich das Transzendente mit ausgeklammert. Da sich alle Religionen in ihren Glaubensinhalten widersprechen, sind die religiösen Vorstellungen rein statistisch gesehen nur individuelle oder gesellschaftlich akzeptierte archaische Imaginationen ihrer Vertreter. Auch die Probleme mit der Suche nach Sinn, Halt und Ordnung sowie nach Mut und Trost werden durch den Begriff Imaginalität aus einer anderen Perspektive angegangen. In der Evolution gibt es keine Ziele. Es gibt nur die Anpassung und persönliche Ziele. Also einen Sinn, Halt und eine Ordnung, die sich jeder selbst geben muss. Individuelle Imaginationen helfen uns dabei, diese zu finden, auch wenn es sich nur um vorläufige Wunschbilder handelt. Die Welt kann zu dem werden, was wir daraus machen wollen, wenn wir uns unserer Imaginalität bewusst werden. Religiöse und gläubige Humanisten ruft dieser Begriff zu etwas Bescheidenheit auf, weil er deutlich macht, dass jede „Jenseits-Vorstellung“ nur unsere eigene individuelle Vorstellung ist. Für die humanistische Sterbehilfe bedeutet er, dass wir die Imaginationen anderer als Teil ihrer Persönlichkeit respektieren können. So kann auch ein Atheist mit einem Sterbenden beten, weil er es für den Menschen tut und nicht für seine Götter.
Was ist zu tun?
Manchmal ist es besser Ideen sterben zu lassen, als sich über die weitere Verwendung von Begriffen zu streiten. Ob sich das Wort Imaginalität in humanistischen Kreisen und in der Forschungslandschaft etablieren wird, hängt davon ab, wie viele Menschen dieser Idee zustimmen, sie in den Alltag aufnehmen und sie so verbreiten. Nennen wir das Kind einfach beim richtigen Namen.
Über den Autor:
Andreas Kilian, Dr. rer. nat, geboren 1963, studierte Chemie und Biologie. Zahlreiche Forschungstätigkeiten, u.a. zur Ausbreitungsdynamik von AIDS/HIV in heterosexuellen Populationen, zur Komplexität menschlichen Verhaltens und zu Fragen der theoretischen Biologie. Neben allgemeinen biologischen Fragen arbeitete er in der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD) sowie an dem Fraunhofer Institut AIS (Autonome Intelligente Systeme) schwerpunktmäßig an ethologischen und soziobiologischen Themen.
Veröffentlichungen:
Egoismus, Macht und Strategien, Alibri, 2009
Die Logik der Nicht-Logik, Alibri, 2010