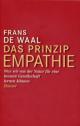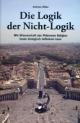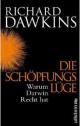Ethik | 20.08.2010
Gibt es ein Recht auf ein gesundes Kind?
 Aus einer säkularen Perspektive gibt es nicht den geringsten Anlass für die Annahme, dass eine befruchtete Eizelle bereits mit einem moralisch und juridisch zu schützenden Recht auf Leben zur Welt kommt.
Aus einer säkularen Perspektive gibt es nicht den geringsten Anlass für die Annahme, dass eine befruchtete Eizelle bereits mit einem moralisch und juridisch zu schützenden Recht auf Leben zur Welt kommt.
Es gibt nach wie vor unterschiedliche Ansichten darüber, worauf Rechte überhaupt beruhen. Die inzwischen am weitesten akzeptierte Theorie geht von der Funktion von Rechten aus. Danach sind Rechte dazu da, elementare Interessen zu schützen. So dienen die Rechte auf Leben, Freiheit und Eigentum beispielsweise dem Schutz unseres Interesses an unserem Leben, unserer Freiheit und unserem Eigentum.
Nach diesem bisweilen auch als „korrespondenztheoretisch“ bezeichneten Ansatz kann einem Wesen nur dann ein bestimmtes Recht zukommen, wenn es über dasjenige Interesse verfügt, das durch dieses Recht geschützt werden soll. So kann man leidensfähigen Tieren beispielsweise durchaus ein Recht auf körperliche Unversehrtheit zusprechen, da wir davon ausgehen dürfen, dass sie ein Interesse daran haben, nicht gequält zu werden. Es wäre jedoch völlig unsinnig, ihnen ein Recht auf Religionsfreiheit einzuräumen, da sie überhaupt keinen Begriff von Religion haben, geschweige denn ein Interesse an der freien Ausübung religiöser Riten.
Wenn man diesen Ansatz zu Grunde legt, ist es offenkundig, dass es keine Rechtfertigung dafür gibt, Embryonen bestimmte Rechte zuzusprechen. Um Rechte in Anspruch nehmen zu können, muss man schließlich über Interessen verfügen. Ein aus acht Zellen bestehender Embryo ist jedoch kein Wesen, das Interessen hat. Ja, er besitzt noch nicht einmal die neuronalen Voraussetzungen dafür, um überhaupt Interessen haben zu können.
Dass Embryonen keinen Anspruch auf Rechte haben, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass man nun nach Belieben mit ihnen umgehen dürfe. So kann es beispielsweise gute Gründe dafür geben, Embryonen nicht zu trivialen – wie etwa kosmetischen – Zwecken zu opfern. Einer Verwendung von Embryonen zu vitalen Zwecken, wie beispielsweise der Entwicklung von Stammzelltherapien, steht jedoch nichts im Wege.
Wenn Kissler seinem Arikel gegen die Präimplantationsdiagnostik den Untertitel „vorgeburtliches Körper-Tuning“ gibt, wird deutlich, dass er nicht die leiseste Ahnung hat, wovon er spricht. Wie die Pränataldiagnostik, so ist auch die Präimplanationsdiagnostik eine Methode zur Früherkennung genetischer Defekte und chromosomaler Aberrationen. Mit einer Manipulation des Genoms hat sie nicht das geringste zu tun.
Eine Frau, die im Rahmen der Pränataldiagnostik, wie etwa einer Amniozentese, gesagt bekommt, dass ihr Fetus von einer Trisomie 21 betroffen ist, steht vor der Wahl, ob sie ihre Schwangerschaft fortsetzen oder abbrechen soll. Derartige Entscheidungen sind zweifellos nicht leicht. Doch inzwischen gehören sie zum klinischen Alltag. Und die allermeisten Frauen begrüßen es, die Entscheidung, ob sie ein Kind großziehen wollen, im Lichte aller relevanten Fakten treffen zu können.