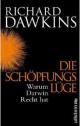Glücksforschung | 08.08.2010
Die frohere Botschaft

In diesem Teil unserer Reihe über Ethik und Glücksforschung geht es um die Frage, welche Gesellschaftsform den Menschen am erfolgreichsten ein langes und glückliches Leben ermöglicht und wie es von nun an weitergeht.
Wie bereits in „Eine Wissenschaft des Glücks“ angedeutet, geht die moderne Gesellschaft als Sieger im Wettstreit um das Glück auf Erden hervor, und je moderner sie ist, desto besser für alle Beteiligten. Aber auch in vielen Stammesgesellschaften leben die Menschen recht glücklich. Agrarische Gesellschaften dagegen schneiden viel schlechter ab als die Konkurrenz. Warum ist das so?
Stammesgesellschaften
Jäger-und-Sammler-Kulturen gibt es zwar heute noch, aber sie sind nur bedingt geeignet, um herauszufinden, wie unsere Vorfahren den Großteil der 50 000 Jahre gelebt haben, seit der Homo sapiens existiert. Von modernen Jägern und Sammlern gibt es positive Berichte, wie über die freie Sexualmoral in Samoa oder einstmals die Beschreibungen der „edlen Wilden“ von Tahiti, wie man sie vom Naturforscher Joseph Banks, der im 18. Jahrhundert mit James Cook zu den südpazifischen Inseln segelte, kennt. Tahiti ist eines der Beispiele, was mit Naturvölkern beim Kontakt mit modernen Gesellschaften passieren kann. Tahitianische Frauen zogen sich von europäischen Männern Geschlechtskrankheiten zu und die Bewohner Tahitis wurden zu großen Teilen alkoholabhängig. Bald war von der utopischen Gesellschaft, die Banks beschrieben hatte, nichts mehr übrig. Soweit die romantische Version.

Zugleich gab und gibt es auch negative Berichte über das Leben von Naturvölkern, darunter gewaltsam versklavte Ehefrauen (etwa in Papua-Neuginea), Sklavenhändler (afrikanische Häuptlinge haben Mitglieder ihrer Stämme an die Europäer verkauft) ständige Kriege zwischen verschiedenen Stämmen und Aberglauben, der zu religiös begründeter Folter, zu Menschenopfern und Kannibalismus führen konnte. James Cook selbst wurde bei seinem dritten Besuch Tahitis im Jahre 1777 Zeuge eines Rituals, das mit einem Menschenopfer endete. Schon Banks hatte die negativen Seiten Tahitis angedeutet, wo Infantizit häufig vorkam und wo Diebstahl an der Tagesordnung war, was die Tahitianer wohl doch nicht so fröhlich stimmte, wie Banks das anfangs vermutete.
Vielleicht wegen ihres Glaubens an den kulturellen Relativismus (Thin 2008) haben Anthropologen bis vor kurzem niemals versucht, die Glücklichkeit von Naturvölkern festzustellen. Die Psychologen Biswas-Diener et. al. (2005) haben jüngst eine Studie über die Glücklichkeit der Inughuit, Amesch und Maasai angefertigt und herausgefunden, dass die Viehzucht-treibenden Maasai ungefähr so glücklich sind wie Menschen in modernen westlichen Gesellschaften, während die Landwirtschaft-betreibenden Amesch viel unglücklicher leben.
Der Soziologe Ruut Veenhoven, auf dessen Arbeit „Das Leben wird besser“ dieser Artikel überwiegend beruht, bevorzugt die historische Anthropologie, die auf archäologischen Funden basiert, auch wenn diese nur ein bruchstückhaftes Bild vom Leben unserer Vorfahren vermitteln. Als einschlägige Arbeiten nennt er Maryanski and Turner (1992) and Sanderson (1995). Ihre Literatur geht, wie ein Großteil der modernen Forschung, davon aus, dass Gruppen von Jägern und Sammlern für den Großteil der menschlichen Existenz die einzige Gesellschaftsform darstellten. Erst vor rund 10 000 Jahren sind allmählich die ersten Gärtner- und dann Agrargesellschaften entstanden. Erst im 18. Jahrhundert formte sich die Industriegesellschaft und im 20. Jahrhundert fing jene damit an, sich in eine Diensleistungsgesellschaft („post-industriell“) umzuwandeln, ein Prozess, der noch im Gange ist.
Jäger-Sammler-Kulturen haben begrenzte Möglichkeiten, ihre Mitglieder zu kontrollieren, da Abweichler sich für eine Weile selbst verpflegen können und weil sie die Option haben, anderen Gruppen beizutreten. Da Jäger und Sammlung insofern kaum andere für sich arbeiten lassen, ist die Anhäufung von Reichtum und Macht schwierig unter diesen Bedingungen. Darum neigt diese Art von Gesellschaft dazu, frei und egalitär zu sein. Da unsere Vorfahren, auch die Hominiden, die dem Homo sapiens vorangingen, in Jäger-und-Sammler-Kulturen gelebt haben, hat diese Lebensweise Spuren in unserer Psyche hinterlassen. Dies dürfte zur Erklärung der starken Korrelation zwischen Einkommensungleichheiten und Gesellschaftskrankheiten beitragen: Wir sind offenbar auf ein Leben unter Gleichen programmiert, was man aber auch nicht überinterpretieren sollte.