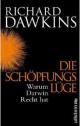Reihe Pioniere der Evolutionstheorie | 13.05.2011
Die Evolution vor der Evolutionstheorie

In den nächsten Monaten wird hier im Evomagazin eine neue Reihe erscheinen, die die Pioniere der Evolutionsforschung vorstellen wird. Den Auftakt zu dieser Reihe macht nun ein Beitrag von Rüdiger Vaas, der die Evolution der Evolutionstheorie beleuchtet. Die Redaktion wünscht viel Spaß bei der Lektüre!
Die Evolution vor der Evolutionstheorie
Von Rüdiger Vaas
Die Initialzündung der modernen Evolutionstheorie erfolgte 1859, als der Naturforscher Charles Darwin sein Buch "On the Origin of Species" veröffentlichte. Seither ist das menschliche Selbst- und Weltverständnis ein anderes. Keine naturwissenschaftliche Erkenntnis davor oder danach hatte vergleichbare Auswirkungen. Allerdings stammt der Evolutions- und Entwicklungsgedanke nicht von Darwin, sondern ist viel älter.
Von der Urzeugung zur zurückbebenden Vernunft
Über die Entstehung und Vielfalt der Lebewesen haben Menschen schon seit langem nachgedacht, und viele geben sich noch immer mit der Vorstellung eines göttlichen Schöpfungsakts (oder mehrerer) zufrieden. Die vorsokratischen Philosophen im griechischen Raum suchten hingegen nach natürlichen Erklärungen und erkannten bereits die Bedeutung der Umwelt und langer Zeiträume. Viele gingen von einer (durchaus "naturalistisch" geachten) "Urzeugung" aus, ohne diese freilich zu verstehen.
 Anaximander (circa 611 bis 546 v.Chr., rechts auf dem Bild) spekulierte über viele Urzeugungen und eine Entstehung des Lebens aus Feuchtigkeit. Er verglich sie mit der Metamorphose von Insekten. Auch der Mensch hatte ihm zufolge einen solchen Gestaltwandel durchlaufen und war ursprünglich fischähnlich. Empedokles (circa 495 bis 435) nahm an, dass vor den Tieren die Pflanzen entstanden sind und mutmaßte über eine vierstufige Entwicklung.
Anaximander (circa 611 bis 546 v.Chr., rechts auf dem Bild) spekulierte über viele Urzeugungen und eine Entstehung des Lebens aus Feuchtigkeit. Er verglich sie mit der Metamorphose von Insekten. Auch der Mensch hatte ihm zufolge einen solchen Gestaltwandel durchlaufen und war ursprünglich fischähnlich. Empedokles (circa 495 bis 435) nahm an, dass vor den Tieren die Pflanzen entstanden sind und mutmaßte über eine vierstufige Entwicklung.
Platon (427 bis 348/9), "der große Antiheld der Evolutionslehre" (Ernst Mayr), glaubte an unveränderliche Ideen und somit statische Arten als deren Manifestation – eine Auffassung, die erst im 19. und 20. Jahrhundert überwunden wurde. Aristoteles (384 bis 322) folgte seinem Lehrer darin und betrachtete alles Werdende als der Art nach ewig. Übergänge existierten ihm zufolge nicht ("nicht jedes Beliebige aus jeglichem Samen, sondern aus einem bestimmten Samen nur ein bestimmtes Ding"), doch er postulierte eine "Stufenleiter" der Natur ("scala naturae").
Auch der Atomist Lukrez (circa 98 bis 55) ging von einer Urzeugung und Konstanz der Arten aus, aber einer veränderlichen Welt. Er akzeptierte, dass manche Lebewesen ausstarben und nahm an, sie seien von der Erde "gleichsam zur Probe" geschaffen worden – Scheusale und Wundergeschöpfe, die nicht überlebens- oder fortpflanzungsfähig waren.
Bei allen Unterschieden zog sich die Annahme einer Konstanz der Arten also durch die Jahrhunderte. Sie galten als unveränderlich und als untereinander scharf abgegrenzt. Verwandtschaftsbeziehungen wurden nur innerhalb einer Art akzeptiert – zwischen Individuen, Rassen oder Varietäten. Erst mit der Aufklärung, Philosophie und Naturforschung im 18. Jahrhundert bekam diese typologische Theorie von "Ideen" oder festen "Bauplänen" Konkurrenz, und die Entstehung der Arten wurde zu einem wissenschaftlichen Problem.
 Immanuel Kant (1724 bis 1804, Bild links) spekulierte 1755 über eine Entwicklung des Kosmos. Freilich hielt er eine Erkenntnis der Ursachen des Kosmos eher für möglich, als dass "die Erzeugung eines einzigen Krauts oder einer Raupe, aus mechanischen Gründen, deutlich und vollständig kund werden" würde. Als "gewagtes Abenteuer der Vernunft" erwog er dann 1790 im Rahmen einer Kritik von Johann Gottfried Herders (1744 bis 1803) Stufenleiter-Theorie alternative Verwandtschaftserklärungen: zum einen durch Evolution, indem "eine Gattung aus der andern, und alle aus einer einzigen Originalgattung" entstanden; und zum anderen durch einen Ursprung, indem die Gattungen aus einem "einzigen erzeugenden Mutterschoße" entsprangen. Doch Kant schreckte vor diesen kühnen Gedanken zurück, denn er ahnte, dass beide Möglichkeiten zu Schlussfolgerungen führen würden, die "so ungeheuer sind, dass die Vernunft vor ihnen zurückbebt".
Immanuel Kant (1724 bis 1804, Bild links) spekulierte 1755 über eine Entwicklung des Kosmos. Freilich hielt er eine Erkenntnis der Ursachen des Kosmos eher für möglich, als dass "die Erzeugung eines einzigen Krauts oder einer Raupe, aus mechanischen Gründen, deutlich und vollständig kund werden" würde. Als "gewagtes Abenteuer der Vernunft" erwog er dann 1790 im Rahmen einer Kritik von Johann Gottfried Herders (1744 bis 1803) Stufenleiter-Theorie alternative Verwandtschaftserklärungen: zum einen durch Evolution, indem "eine Gattung aus der andern, und alle aus einer einzigen Originalgattung" entstanden; und zum anderen durch einen Ursprung, indem die Gattungen aus einem "einzigen erzeugenden Mutterschoße" entsprangen. Doch Kant schreckte vor diesen kühnen Gedanken zurück, denn er ahnte, dass beide Möglichkeiten zu Schlussfolgerungen führen würden, die "so ungeheuer sind, dass die Vernunft vor ihnen zurückbebt".
Multidisziplinäre Voraussetzungen
Historisch betrachtet gab es mehrere unterschiedliche Einflüsse auf die Entwicklung der Evolutionstheorie.
Geologie: Die Erde muss sehr alt sein. Das lässt sich schließen aus den Sedimenten und vulkanischen Ablagerungen, ihren Schichtung und Faltungen sowie der Erosion durch Wasser. Die Einzelheiten waren umstritten – so gab es eine große Kontroverse zwischen Neptunisten und Vulkanisten, die das Wasser beziehungsweise Feuer als treibende Kraft ansahen – aber ein "biblisches" Erdalter von vielleicht 6000 Jahren ließ sich nicht mehr halten. Vielmehr sollten nur Kräfte wirken, die sich auch jetzt noch beobachten lassen (Aktualitätsprinzip). Das wahre Erdalter wurde freilich lange unterschätzt, und so geriet Darwin später sogar mit dem Physiker William Thompson (Lord Kelvin, 1824 bis 1907) in Konflikt, der es auf nur 100 Millionen Jahre schätzte.
Biogeographie: Die großen Seereisen führten zur Entdeckung zahlreicher bis dahin unbekannter Tier- und Pflanzenarten. So beschrieb beispielsweise schon 1532 der Botaniker Otto Brunfels (1488 bis 1534) 240 neue pflanzliche Spezies und 1623 der Botaniker Caspar Bauhin (1560 bis 1624) sogar 6000. Die übliche Auffassung von einem einzigen Ausbreitungszentrum aller Arten musste revidiert werden, stattdessen wurden nun mehrere "Schöpfungszentren" postuliert.
Mikroskopie: Die Erfindung des Mikroskops um 1600 eröffnete seit dem Einsatz ein paar Jahrzehnte später in der Biologie durch Antoni van Leeuwenhoek (1632 bis 1723) mit einer bis zu 270fachen Vergrößerung einen neuen Beobachtungsbereich für die Naturforscher und schien zunächst auch die These von der Urzeugung zu bestätigen – was den Erkenntnisfortschritt hemmte, weil es die Möglichkeit von Veränderungen obsolet machte.
Paläontologie: Immer mehr Fossilien wurden ausgegraben und studiert. Sie passten nicht zu den noch lebenden bekannten Tier- und Pflanzenarten und erforderten eine Erklärung. Verschiedene Szenarien wurden diskutiert, darunter die auf den Arzt und Philosophen Avicenna (980 bis 1037) zurückgehende Annahme von Naturspielen der "vis plastica" der Erde (die einen "Abdruck" aller Lebensformen im Gestein hinterließ), von ausgestorbenen Lebewesen infolge der Sintflut und von wiederkehrenden erdgeschichtlichen Umwälzungen (Katastrophismus) sowie einer Neuentstehung von Arten. Dafür trat besonders prominent Georges Cuvier (1769 bis 1832) ein, der die vergleichende Anatomie und Paläontologie begründet hat.
Anatomie: Scheinbar sehr verschiedenartige Organismen haben ähnliche "Grundbaupläne", beispielsweise hinsichtlich des Skeletts oder der inneren Organe. Das erkannte der Anatom Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772 bis 1844) schon deutlich, der von einem einheitlichen Bauplan der Tiere sprach und daraus auf ihre Verwandtschaft schloss. Das tat auch der Zoologe Robert Edmond Grant (1793 bis 1874), der über Schwämme und Polypen als Ursprungsformen spekulierte; Darwin studierte bei ihm in Edingburgh.
Embryologie: Die Entwicklung der Wirbeltiere folgt einem Grundbauplan, ebenso der Weichtiere. Es muss also eine begrenzte Zahl gruppenspezifischer Typen geben, folgerte der Zoologe Karl Ernst von Baer (1792 bis 1876) in seinem 1828 erschienenen Buch "Über Entwickelungsgeschichte der Thiere".
Züchtung: Haustiere und Kulturpflanzen in ihren recht unterschiedlichen Varianten regten schon den Naturforscher Georges Louis Leclerc Buffon (1707 bis 1788) zu Spekulationen über die Verwandtschaft der Lebewesen an.
Philosophie: Fortschrittsideen wurden Mode und auch auf die Natur übertragen. Die These einer "Stufenleiter der Natur" (scala naturae) war ein Abbild einer solchen Progression, wurde aber als unveränderlich angesehen. Mit der philosophischen Aufklärung wuchs das Gewicht von natürlichen Erklärungen und materialistischen Weltbildern. Die Bibel verlor zunehmend an Autorität, jedenfalls als Quelle naturgeschichtlicher Erklärungen. Die weltanschaulichen Überzeugungen vieler Forscher verschoben sich vom Theismus zum Deismus oder Atheismus und Materialismus. Freilich kam es dabei aber auch zu einer Überbetonung der exakten und experimentellen Wissenschaften (Physik, Chemie); dadurch wurde die Suche nach Erklärungen für die Vielfalt der Lebensformen vernachlässigt, zumal die Naturgeschichte (Biologie, Paläontologie, Geologie) häufig noch das Steckenpferd von Pfarrern war.
Vererbung erworbener Eigenschaften?
Als hinderlich für den Evolutionsgedanken wirkten abgesehen von den philosophischen Vorurteilen einschließlich der quasiplatonistischen Typenlehre vor allem die vermeintlichen Beobachtungen von Urzeugungen (und somit eine Ignorierung von Veränderungsmöglichkeiten) sowie die Überschätzung der Beobachtbarkeit (ein Artwandel dauert zu lange, um ihn zu erkennen). Es war erst der Zoologe und Botaniker Jean-Baptiste-Antoine-Pierre de Monet Chevalier de Lamarck (1744 bis 1829), der die langen Zeiträume der Erdgeschichte, die in der Geologie immer deutlicher wurden, ernst nahm. Und er berücksichtigte sie in der Biologie – diesen Begriff für die "Wissenschaft vom Leben" hatte er übrigens 1802 geprägt, wie auch unabhängig Karl Friedrich Burdach (1776 bis 1847) und Gottfried Reinhold Treviranus (1776 bis 1836).
Zunächst ebenfalls ein Anhänger der scala naturae und aufeinanderfolgender Urzeugungen, deutete Lamarck die Kreide- und Muschelkalkbänke sowie Kohlenlager als organische Ablagerungen und als Indiz für einen Wandel der Arten (Transformation). Sie "verändern sich wirklich nur so langsam, dass der Mensch diese Veränderungen nicht beobachten kann". In seiner "Philosophie Zoologique" (1809) spekulierte er über die Ursachen dieses Wandels: Er postulierte eine direkte Anpassung der Organe an ihre Funktion und Umwelt durch ihren Gebrauch beziehungsweise Nichtgebrauch (bei Rückbildungen); durch "neue Gewohnheiten auferlegt" habe "sich daraus der vorzugsweise Gebrauch eines Teiles vor einem anderen ergeben" und "in gewissen Fällen der vollständige Nichtgebrauch eines Teiles, das unnütz geworden ist".
Außerdem postulierte er eine Vererbung dieser erworbenen Eigenschaften, die er als aktiven Prozess verstand (nicht als passive Mutationen). "Bei jedem Tiere [...] stärkt der häufigere und dauernde Gebrauch eines Organs dasselbe allmählich [...]; der konstante Nichtgebrauch eines Organs macht dasselbe schwächer [...] und lässt es schließlich verschwinden. [...] Alles, was die Individuen durch den Einfluss der Verhältnisse, denen ihre Rasse lange Zeit hindurch ausgesetzt ist, und folglich durch den Einfluss des vorherrschenden Gebrauchs oder konstanten Nichtgebrauchs eines Organs erwerben oder verlieren, wird durch die Fortpflanzung auf die Nachkommen vererbt."
 Zu den Beispielen, die Lamarck (Bild rechts) diskutierte, gehören der lange Hals der Giraffe und die funktionslosen Augen des Höhlenmolchs. Die Veränderungen erfolgten für Lamarck indirekt auf physiologischem Weg, nicht direkt durch die Umwelt wie nach der Auffassung des Evolutionisten und Anatomen Etienne Geoffroy Saint-Hilaire und des später aufkommenden Neolamarckismus. Psychische Faktoren spielten für Lamarck keine Rolle, im Gegensatz zum Psycholamarckismus.
Zu den Beispielen, die Lamarck (Bild rechts) diskutierte, gehören der lange Hals der Giraffe und die funktionslosen Augen des Höhlenmolchs. Die Veränderungen erfolgten für Lamarck indirekt auf physiologischem Weg, nicht direkt durch die Umwelt wie nach der Auffassung des Evolutionisten und Anatomen Etienne Geoffroy Saint-Hilaire und des später aufkommenden Neolamarckismus. Psychische Faktoren spielten für Lamarck keine Rolle, im Gegensatz zum Psycholamarckismus.
Akademisch wurde Lamarcks Hypothese zunächst überwiegend ignoriert oder sogar verspottet. Unabhängig von den weltanschaulichen Kontroversen hatte sie den großen Nachteil, dass sie zwar erstmals den Artwandel erkannte und zu erklären versuchte, nicht aber die Artenvielfalt. Eine gemeinsame Abstammung und somit einen Stammbaum der Arten hatte Lamarck nicht postuliert.
Dieser Text ist ein kurzer Auszug aus:
Rüdiger Vaas: Die Evolution der Evolution. Universitas Bd. 64, Nr. 751, S. 4-29 (Januar 2009). Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung durch den Autor Rüdiger Vaas.