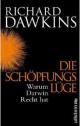Religion | 02.02.2009
Gott, Gene und Gehirn: Die Evolution der Religiosität
Was sind die Kriterien für eine evolutionsbiologische Erklärung der Religiosität als Anpassung?
Wenn Religiosität im Allgemeinen einen direkten Anpassungswert besitzt oder wenn wenigstens bestimmte Merkmale der Religiosität einen solchen aufweisen, dann müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein: Nötig sind plausible Indizien für einen Reproduktionserfolg, für die Erblichkeit und physische Realisierung sowie ein Nachweis, worin der Selektionsvorteil besteht.
Im folgenden erläutere ich diese Kriterien und skizziere sehr kurz den aktuellen Forschungsstand. (Viele weitere Informationen und Angaben zu den Fachpublikationen enthalten die Literaturhinweise am Ende.)
• Reproduktionserfolg
 Das Merkmal muss seinen Trägern mindestens mittelfristig eine höhere Fortpflanzungsrate bescheren. Die Merkmalsträger müssen im Durchschnitt und über eine viele Generationen hinweg also mehr Nachkommen haben als die innerartlichen Konkurrenten. Das ist eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung für einen Selektionsvorteil.
Das Merkmal muss seinen Trägern mindestens mittelfristig eine höhere Fortpflanzungsrate bescheren. Die Merkmalsträger müssen im Durchschnitt und über eine viele Generationen hinweg also mehr Nachkommen haben als die innerartlichen Konkurrenten. Das ist eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung für einen Selektionsvorteil.
In den letzten Jahrzehnten hatten religiöse Menschen überall auf der Welt im Durchschnitt mehr Nachkommen. Ob dies aber immer der Fall war, lässt sich nicht beweisen. Das ist allerdings eine entscheidende Frage, denn wenn Religiosität einen Selektionsvorteil hat, dann müsste sich der schon vor einigen 10000 bis 100000 Jahren ausgebildet haben. Es ist aber fraglich, ob Religiosität damals universell war oder, aus moderner Perspektive, ob es überhaupt viele Nichtreligiöse gegeben hat. Und selbstverständlich folgt aus einer höheren Kinderzahl nicht zwingend eine  biologische Anpassung. Zudem spielen heute Faktoren wie Bildung und Einkommen eine entscheidende Rolle. (Bildung korreliert in der Regel mit weniger Kindern und geringerer Religiosität.) Ferner müsste nachgewiesen werden, dass die unterschiedlichen Reproduktionsraten statistisch signifikant mit der Ausbreitung von Genen einhergehen, die eine verstärkte Religiosität – oder einzelne Merkmale von dieser – bewirken. Allein, was die Häufigkeitsverteilung von Genen über Generationen hinweg und gerichtet verschiebt, lässt auf einen Selektionsdruck schließen. Eine durchschnittlich größere Reproduktion religiöser Menschen heute impliziert für sich genommen also noch gar nichts.
biologische Anpassung. Zudem spielen heute Faktoren wie Bildung und Einkommen eine entscheidende Rolle. (Bildung korreliert in der Regel mit weniger Kindern und geringerer Religiosität.) Ferner müsste nachgewiesen werden, dass die unterschiedlichen Reproduktionsraten statistisch signifikant mit der Ausbreitung von Genen einhergehen, die eine verstärkte Religiosität – oder einzelne Merkmale von dieser – bewirken. Allein, was die Häufigkeitsverteilung von Genen über Generationen hinweg und gerichtet verschiebt, lässt auf einen Selektionsdruck schließen. Eine durchschnittlich größere Reproduktion religiöser Menschen heute impliziert für sich genommen also noch gar nichts.
• Erblichkeit
Das Merkmal muss genetisch festgelegt sein. Denn nur was vererbt wird, kann ein Gegenstand der Selektion sein. Das heißt freilich nicht, dass die erblichen Merkmale stets unabhängig von Umwelteinflüssen ausgeprägt werden. Im Gegenteil: Gerade Fähigkeiten und Fertigkeiten des Denkens und Verhaltens hängen stark von prägenden Reizen ab. So ist die menschliche Sprachfähigkeit zwar angeboren, kann sich ohne eine „sprachliche Umwelt“ aber nicht entwickeln.
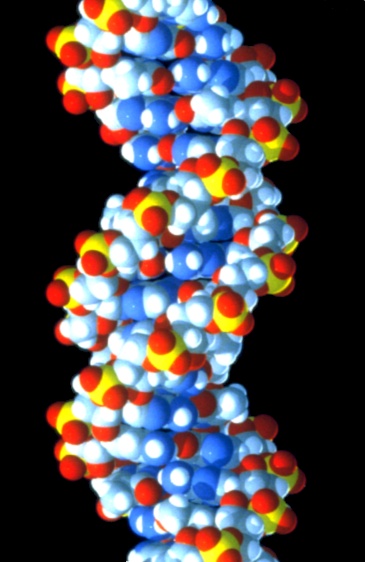 Es gibt Indizien dafür, dass Aspekte der Religiosität – besonders die Stärke von spirituellen Neigungen und von Autoritätsgläubigkeit – signifikant genetisch mitbedingt sind. Aber das bedeutet per se noch keinen Nachweis von Adaptivität. (Selbst genetisch völlig fixierte Merkmale wie Augenfarben können evolutionär neutral sein.) Für Religiosität als strenges Anpassungsmerkmal (wie es etwa der Besitz von Lungen ist) existiert kein Hinweis – und dann dürften die individuellen genetischen Unterschiede auch kaum variieren. Denn die Selektion reduziert die Variabilität und lässt oft gerade das übrig, was adaptiv keine große Rolle spielt.
Es gibt Indizien dafür, dass Aspekte der Religiosität – besonders die Stärke von spirituellen Neigungen und von Autoritätsgläubigkeit – signifikant genetisch mitbedingt sind. Aber das bedeutet per se noch keinen Nachweis von Adaptivität. (Selbst genetisch völlig fixierte Merkmale wie Augenfarben können evolutionär neutral sein.) Für Religiosität als strenges Anpassungsmerkmal (wie es etwa der Besitz von Lungen ist) existiert kein Hinweis – und dann dürften die individuellen genetischen Unterschiede auch kaum variieren. Denn die Selektion reduziert die Variabilität und lässt oft gerade das übrig, was adaptiv keine große Rolle spielt.
• Realisierung
Das Merkmal muss eine (genetisch mitbedingte) physische Basis haben, sonst wäre es kein Teil der Natur und somit auch nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden empirisch zu erforschen. Im Fall von Verhaltensmerkmalen sowie kognitiven Eigenschaften im weitesten Sinn muss das Merkmal also auf Strukturen und Vorgängen des Nervensystems basieren.
Dass der Glaube auf Gehirnprozessen beruht, ist weithin akzeptiert; und einige Aspekte davon wurden bereits entdeckt. Allerdings sind die meisten neuronalen Korrelate noch umstritten und, wie die kognitiven Eigenschaften, nicht unbedingt spezifisch für Religiosität oder deren verschiedene Einzelmerkmale. Außerdem ist die Existenz spezifischer Hirnvorgänge kein hinreichendes Argument für Adaptivität – zum Beispiel gibt es auch neuronale Korrelate für das Schreib- und Lesevermögen, die sogar selektiv ausfallen können (bei neurologischen Störungen wie Agraphie und Alexie), ohne dass sie eine evolutionäre Anpassung wären.
• Selektionsvorteil
Wodurch das Merkmal adaptiv ist, worin also sein Anpassungswert besteht, muss erkenntlich sein.
Es gibt zahlreiche Überlegungen, die den religiösen Glauben und den damit verbundenen Aufwand nicht als „überflüssigen Luxus“, sondern als vorteilhaft interpretieren. Besonders im Fokus der Forschung sind die folgenden Hypothesen (die sich nicht gegenseitig ausschließen müssen, sondern sich vielmehr ergänzen und verstärken, aber auch situationsabhängig verändern können):
Individuell:
• Orientierung und Welterklärungen: Warum das, was ist, so ist, wie es ist und überhaupt ist.
• Kontingenzbewältigung: Trost und Schutz, Bedeutung und Erhöhung, Ordnung und Sinn angesichts von Leiden, Krankheit und Sterben, Armut, Elend, Ungerechtigkeiten und „dem Bösen“, Einsamkeit und Weltangst
• Glück und Gesundheit: psychisches Placebo, weniger Stress, bessere soziale Einbindung, Verringerung von Risiken
Individuell und sozial (durch die Beeinflussung anderer):
• Machthaber können damit ihre Macht gewinnen, rechtfertigen und erhalten.
• Moralische Vorschriften werden begründet und durchgesetzt – fast jede Religion verfügt über ein reiches Spektrum von Geboten und Verboten.
• Menschen werden motiviert und manipuliert – bis hin zu „heiligen Kriegen“ und dem Märtyrertum.
• Religion macht das Leben in den Gruppen, ja in großen Gesellschaften eventuell sicherer, harmonischer und effizienter.
• Gruppen lassen sich nach innen stabilisieren und nach außen abgrenzen.
• Kooperation – und somit Altruismus und Vertrauen – werden durch gemeinsame Religiosität gefördert, die auch eine Ausbeutung durch egoistische „Trittbrettfahrer“ weniger anfällig macht. Der wechselseitige Altruismus kann sowohl die natürliche Selektion begünstigen als auch die sexuelle Selektion, wenn die Partnerbindung langfristig gestärkt wird („Treue“ und Unterstützung), was wiederum der Reproduktion förderlich ist.